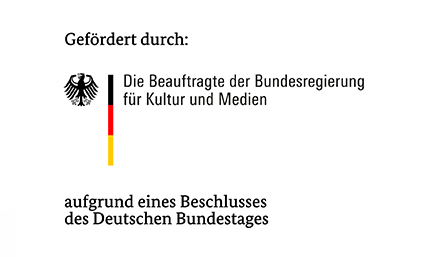Langensteiner Kreis für Fasnachtsforschung 2014

Am 29. November 2014 fand im Festsaal des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein die 28. Tagung des Langensteiner Kreises statt. Thema war der Einfluss maschinell gefertigter Larven auf die Fasnacht.
Im Rahmen der Industrialisierung fanden beispielsweise Drahtsiebmasken durch neue Fertigungsmethoden und technische Entwicklungen weltweite Verbreitung. Etwa in Thüringen entwickelte sich seit 1800 eine umfangreiche Maskenfabrikation. Sichtbare Spuren dieser industriell gefertigten Larven finden sich heute noch in vielen Fasnachten.
Seit dem 20. Jahrhundert werden auch Holzlarven zunehmend seriell produziert, sie werden dadurch für jedermann erschwinglich was das Wachstum von neuen Narrengruppen fördert und mittlerweile die Fasnacht auch in Gegenden exportiert die nicht zum eigentlichen Kernraum gehören.
In Basel waren die (Pappmaché-)Larven anfänglich industriell gefertigt und wurden erst später in vielen Ateliers in tradierten Handwerkstechniken hergestellt. Wie diese Entwicklung maßgeblich zur Einzigartigkeit der Basler Fasnacht beigetragen hat und wie dadurch mittlerweile auch das Aussehen anderer Fasnachten in der näheren Umgebung beeinflusst wurde sind nur einige der spannenden Fragestellungen die unsere Referenten Dominik Wunderlin (Basel), Andreas Reutter (Weingarten) und Helmut Kubitschek (Freiburg) zu beantworten versuchten.

Programm 2014:
Traditionen und Transformationen
Methoden der Maskenfertigung und ihr Einfluss auf Fasnachtsbräuche
Helmut Kubitschek
Maske als Massenware. Die Etablierung der Holzmaske durch halbmaschinelle Reproduktion.
Andreas Reutter
Zur Entwicklung der Drahtsieblarve als Brauchmaskierung.
Dominik Wunderlin
Methoden der Fertigung und ihr Einfluss auf Fasnachtsbräuche, gezeigt am Beispiel der kaschierten Basler Larve